|
Artikelarchiv von Maja Langsdorff
Der folgende Artikel erschien am 1. Juli 2008 in der »Stuttgarter Zeitung«.
|
 Mit der Maus auf der Suche nach Gesundheitstipps
Mit der Maus auf der Suche nach Gesundheitstipps
Auf der Suche nach Qualitätskriterien für Gesundheitsinformationen aus dem Internet / Qualitätssiegel
als Versuch, die Spreu vom Weizen zu trennen
In Opas Bücherschrank stand er stets griffbereit: »Der kleine Hausdoktor – Das Allernötigste
zur Selbstbehandlung von Mensch und Tier«. Heute braucht man keine Medizinlexika mehr zu
wälzen – Gesundheitsinfos gibt's zuhauf im Web. Doch wie findet man seriöse Angebote?
von Maja Langsdorff
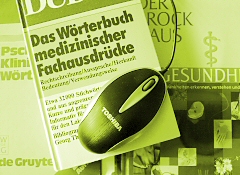 Wie ein kleiner Schorf sieht der leicht erhabene Fleck aus. Beim Waldspaziergang hat sich etwas in der Kniebeuge
festgebissen – Zeckenalarm, was nun? Fehlen guter Rat und Zeckenzange, greift der Internetkundige zur Maus
und googelt. Wartezeiten und Praxisgebühr entfallen, und das Web ist rund um die Uhr erreichbar. Doch die
Informationsflut ist überwältigend. Zum Stichwort »Zeckenbiss« wirft die Suchmaschine Google
mehr als hunderttausend Treffer aus, zum Suchbegriff »Zecke« sogar fast eineinviertel Millionen.
Die Spreu vom Weizen zu trennen und herauszufinden, wer online fundiert informiert, bleibt dem User selbst überlassen. Wie ein kleiner Schorf sieht der leicht erhabene Fleck aus. Beim Waldspaziergang hat sich etwas in der Kniebeuge
festgebissen – Zeckenalarm, was nun? Fehlen guter Rat und Zeckenzange, greift der Internetkundige zur Maus
und googelt. Wartezeiten und Praxisgebühr entfallen, und das Web ist rund um die Uhr erreichbar. Doch die
Informationsflut ist überwältigend. Zum Stichwort »Zeckenbiss« wirft die Suchmaschine Google
mehr als hunderttausend Treffer aus, zum Suchbegriff »Zecke« sogar fast eineinviertel Millionen.
Die Spreu vom Weizen zu trennen und herauszufinden, wer online fundiert informiert, bleibt dem User selbst überlassen.
Gesundheitsportale, Selbsthilfeorganisationen, Pharmafirmen, Verlage, Kliniken, Krankenkassen, Net-Doktoren sind
nur einige, die Gesundheitsinformationen ins weltweite Netz stellen.

Wie beurteilt man die Qualität der Gesundheitsinfos aus dem Web?
Ob Erste Hilfe, Erfahrungsaustausch, Vorab-, Zusatz- und Hintergrundinformationen zum
Arztgespräch – wer einen Internetzugang hat, kann sich schnell, unkompliziert, anonym
und kostenlos Gesundheitsinformationen aus dem Worldwide Web fischen. Es gibt Kriterien, die
eindeutige Rückschlüsse auf die Qualität der Angebote zulassen, auch wenn Prüfsiegel fehlen.
Aggressive Werbesprache zum Beispiel, Heilsversprechen und Verschwörungs-Theorien sind
Kennzeichen unseriöser Websites. Die Nennung der Sponsoren oder Partner lässt Rückschlüsse
auf denkbare wirtschaftliche Interessen zu; unter Umständen nimmt ja der Geldgeber auf die Inhalte
Einfluss. Ein Blick ins Impressum ist grundsätzlich empfehlenswert.
Seriöse Autoren legen ihre Quellen und ihre Qualifikation offen, informieren
ausgewogen und unabhängig und aktualisieren ihre Informationen regelmäßig. Falls eine
Website Werbung enthält, sollte diese strikt und klar gegen die informierenden Inhalte
abgegrenzt sein. Hilfreich bei der Einschätzung einer Website kann auch die Recherche
sein, welche Ziele der Anbieter verfolgt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
rät denn auch: »Glauben Sie eine Information erst, wenn Sie sie bei mindestens
zwei verschiedenen Informationsanbietern gefunden haben.«
|
| Nützliche und schädliche, unsinnige und
lückenhafte Infos liegen oft nur einen Mausklick auseinander. Schon vor acht Jahren konnte man im EU-Informationsbrief
Gesundheit lesen, dass 70 bis 80 Prozent der im Internet verbreiteten Informationen zu Gesundheitsfragen falsch
oder veraltet sind; bei nicht wenigen Seiten schwingen klar kommerzielle Interessen mit. Im stetig wachsenden,
unüberschaubaren Wust von Gesundheitsseiten sucht der medizinische Laie weiter wie nach der Stecknadel im Heuhaufen –
und oft vergeblich nach Qualitätskriterien.
Es gibt unterschiedliche Ansätze, Internetnutzern einen Weg durch den Informationsdschungel im Cyberspace zu weisen
und zu verlässlichen Informationen zu führen. Ein Versuch sind Gütesiegel für Seiten, die bestimmten Anforderungen
genügen. Am bekanntesten ist das Logo der gemeinnützigen Schweizer Stiftung »Health on the Net«
(HON), mit dem seit 1996 Anbieter ihre Website schmücken können, wenn sie die
bestimmte Mindeststandards für vertrauenswürdige Gesundheitsinfos erfüllen. Der HON-Verhaltenskodex listet acht
Punkte von Sachverstand bis Transparenz auf. Die Selbstverpflichtung als Basis für die Logo-Vergabe ist nur ein
Schwachpunkt. Es fehlt auch, so Kritiker, an Prüfmechanismen für die geforderten Standards. Zudem lassen sich
Logos kopieren und auf die eigene Site packen – wer klickt schon darauf und bemerkt die Fälschung, wenn
kein Link zu Informationen über den Anbieter hinterlegt ist. Und schließlich: Prüfsiegel bürgen nicht für die
inhaltliche Richtigkeit medizinischer Informationen – das gilt selbst für so ambitionierten Angebote wie
das Siegel des Verbunds Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem (afgis).
Dennoch ist ein Qualitätsnachweis per Logo »besser als nix«, urteilt Professorin Marie-Luise Dierks
von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie empfiehlt, bei nicht zertifizierten Seiten stets zu schauen:
»Wer ist der Autor? Wie ist seine Qualifikation? Welche Interessen verfolgt er? Wann wurde die Site zuletzt
aktualisiert?«, und sich »nicht allein von einer Seite inspirieren zu lassen – die Vielfalt
macht es!«
Die Leiterin der Patientenuniversität arbeitet mit am deutschen Discern-Projekt),
das einen anderen Weg geht und ursprünglich für die Bewertung schriftlicher Patienteninformationen entwickelt wurde.
Discern bewertet auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse – evidenzbasiert – die Qualität
von Online-Angeboten und erleichtert so medizinischen Laien und Patienten die Orientierung bei der virtuellen Ratsuche.
Eines der Gesundheitsportale, das die Discern-Bewertung nutzt, ist die mit dem HONcode zertifizierte
Patienten-Information.de des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der
Medizin (ÄZQ). Gute Adressen für Surfer sind auch das medizinische Infoleitsystem
Medinfo und das 2006 im Beisein von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
freigeschaltete Angebot Gesundheitsinformation.de des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiK) – das allerdings im Fall von Zecken beispielweise
nur weiterhilft, wenn man über Vorkenntnisse verfügt und unterm Stichwort »Borreliose« sucht.
Vorinformiert sind jedoch viele User. Denn Hauptmotive, im Internet nach medizinischen Informationen zu suchen, sind
»Frustration und Unzufriedenheit über ausbleibende Behandlungserfolge und mangelnde Aufklärung durch den
Arzt«, so der in Kanada lebende Cybermedizin-Experte Gunther Eysenbach. Das knappe Zeitkontingent des Arztes
– im Schnitt dauert eine Konsultation siebeneinhalb Minuten – lässt besonders häufig chronisch Kranke im
Internet nach einer zweiten Meinung suchen. Doch das Internet nimmt dem Arzt keinen Patienten weg, auch wenn es
die traditionelle Arzt-Patienten-Beziehung beeinflusst. Gute Sites erkennt man nämlich auch daran, dass sie User
immer auf die Grenzen der Online-Behandlung hinweisen und darauf, dass Onlinerecherchen nie den Gang zum Arzt und
den zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen können.
|